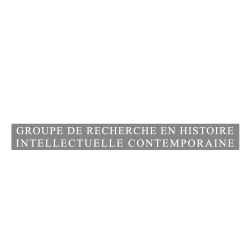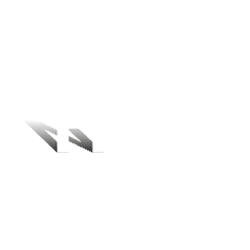neu
populär
Der „zweite Weg“ für die Dritte Welt
1970 bis 2000
Ethnographische Museen nehmen ihrem Wesen gemäss an den Kulturbeziehungen eines Landes teil.
Die Auslandschweizer im Dienst der kulturellen Ausstrahlung
1916 bis 1976
Lange ist die Schweiz ein Auswanderungsland, das seine Bewohner in Zeiten wirtschaftlicher Schwier
Die Schweizerische UNESCO-Kommission: ein Instrument der Kulturbeziehungen
1949 bis 2016
Mit ihrem Beitritt zur UNESCO fügt sich die Schweiz nicht nur in eine Spezialorganisation der UNO
Rousseau Swiss Made
1945 bis 1968
Mit Vorliebe nutzt ihn die Schweizer Kulturdiplomatie, um das Bild der alpinen Idylle, der Schweiz
Ein Einblick in die Schweizer Kultur in Japan
1950 bis 1970
In Japan stehen Buchausstellungen hoch im Kurs, und die Schweizer Verlage nehmen in den 1950er und
Ein junger Historiker durchdenkt die kulturelle Ausstrahlung der Schweiz
1946
Pro Helvetia wird 1939 gegründet, um einen Beitrag an die kulturelle Selbstbehauptung zu leisten.
Architekten zeichnen die Pläne der ersten Kulturbeziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
1945
Nach dem Krieg ist die Frage der Kulturbeziehungen mit Deutschland ein offizielles Tabu.
Die Anfänge des Schweizer Pavillons an der Cité internationale universitaire
1925 bis 1933
Der Schweizer Pavillon an der Cité internationale universitaire von Paris befindet sich an der Sc
Pro Helvetia, Männer... und Frauen!
1939 bis 2012
Pro Helvetia besteht vor allem aus einem Stiftungsrat mit 25 Mitgliedern und einem ständigen Sekre
Kultur und Bildung für den Frieden
1946
„Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert
Die Schweiz im Spiegel der geometrischen Abstraktion
1930 bis 1980
Die geometrische Abstraktion wird im Ausland während des 20. Jahrhunderts vielfach als die typischste...
Plakatausstellungen: die Ästhetik des Nützlichen
1930 bis 1980
Die Gebrauchsgrafik spielt eine wichtige Rolle in der kulturellen Präsenz der Schweiz im Ausland.
Hugo Loetscher entdeckt die Schweiz
1963 bis 1991
Die Laufbahn von Hugo Loetscher verdeutlicht die literarische Dimension der Kulturaussenpolitik.
Das Erwachen der Avantgarde
1956 bis 1985
In der Schweizer Kulturaussenpolitik wird die Gegenwartskunst erst spät berücksichtigt.
Paul Klee: eine Frage der Nationalität
1950 bis 1975
Paul Klees Werke riefen zu Lebzeiten des Künstlers heftige Kritik hervor und fanden in der...
Das Schweizerische Institut in Rom
1949 bis 2010
Das Schweizerische Institut in Rom ist das erste Kulturzentrum der Schweiz im Ausland.
Ramuz und Gotthelf
1945 bis 1960
Bis in die 1960er Jahre findet die zeitgenössische Literatur in der Kulturaussenpolitik kaum...
Pro Helvetia erkundet den afrikanischen Kontinent
1945 bis 1998
Bis in die 1960er Jahre berücksichtigt die Schweizer Kulturpolitik im Ausland Afrika kaum.
Die Geheimnisse der Villa Maraini
1973 bis 1980
Die literarische Karriere von Etienne Barilier führt über das Schweizerische Institut in Rom.